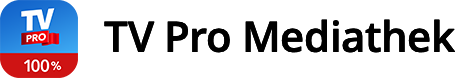scobel (3sat)
Gespräch
Das Wissen der Menschheit nimmt stetig zu. Doch je mehr wir wissen, desto mehr erkennen wir auch, was wir nicht wissen. Und Nichtwissen führt oft zu gesellschaftlichen Verwerfungen. Umgekehrt ist Wissen - und damit eine aufgeklärte Gesellschaft - die Grundlage für eine stabile Demokratie. "Was kann ich wissen?" ist eine von Kants philosophischen Fragen. Und sie ist aktueller denn je. Denn nie war Wissen so flüchtig wie heute. Eine absolute, für alle gleichermaßen gültige Wahrheit gibt es nicht. Es gibt nur Annäherungen an die Wirklichkeit. Das gilt für die Wissenschaft genauso wie für den Journalismus. Die Annäherungen an die Wirklichkeit gelingen mal besser und mal schlechter. Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört das Benennen von Unsicherheiten oder gemachten Einschränkungen. Journalisten legen idealerweise ihre Perspektive auf die Wirklichkeit offen. Das Dilemma des Journalismus: Sender sind nicht mehr auf Sendeanstalten oder Verlage angewiesen. Sie suchen sich ihre eigenen Kanäle, um ihre Wahrheiten zu verbreiten. Social-Media-Kanäle wie TikTok und Telegram sind ohne Aufwand leicht zu bespielen. Eine nach universal gültigen Regeln geprüfte Auswahl von Nachrichten wird immer unbedeutender. Der Weg ist frei für unzählige Wahrheiten auf unzähligen Kanälen. Die Wissenschaft steht vor einem ähnlichen Problem: Wissenschaftliche Arbeiten sind immer weniger von Publikationen in wissenschaftlichen Magazinen abhängig. Auch ihre Verfasser suchen sich ihre eigenen Wege zu den Empfängern und entziehen sich damit den üblichen Prüfprozessen des Wissenschaftsapparats. Stehen wir vor einer Welt ohne Journalismus? Verliert Wissenschaft ihre Glaubwürdigkeit - und damit ihren Wert für die Gesellschaft? Darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen: Wiebke Loosen hat den Lehrstuhl für "Journalistik und Kommunikationswissenschaft" an der Universität Hamburg inne. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehört die Transformation des Journalismus in einer sich verändernden Medienlandschaft. Am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung leitet sie das Forschungsprogramm "Transformation öffentlicher Kommunikation", in dem untersucht wird, wie unter den Bedingungen der Digitalisierung Öffentlichkeit hergestellt und Meinungsbildung ermöglicht wird. Maren Urner forscht zur psychischen und neuronalen Informationsverarbeitung und den Folgen einer Berichterstattung, die überwiegend negatives Wissen thematisiert. Die Neurowissenschaftlerin ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln und Mitbegründerin von "Perspective Daily",einem Online-Magazin für konstruktiven Journalismus. Marcus Willaschek ist ein international renommierter Kant-Experte und lehrt als Professor für Philosophie der Neuzeit an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. An der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist er mitverantwortlich für die wissenschaftliche Standardausgabe der Schriften Kants. Sendung vom 29.08.2024 (3sat)
Diese und 50.000 weitere Sendungen in