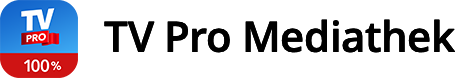Presseclub
Zeitgeschehen
Der brutale Terrorangriff der Hamas hat 1.400 Jüdinnen und Juden das Leben gekostet. Seither steht das Land unter Schock. Der militärische Gegenschlag Israels auf Ziele der Hamas im Gazastreifen fügt aber auch der Zivilbevölkerung dort schweres Leid zu – was zweifellos ganz im Kalkül der Terroristen liegt. Schnell ist dieser Konflikt auch auf deutschen Straßen angekommen. Den Juden in Deutschland schlägt seither von palästinensischen Terrorsympathisanten fanatischer Hass entgegen, ihre Häuser werden mit dem Davidstern beschmiert, Synagogen mit Molotowcocktails angegriffen, einige wagen sich gar nicht mehr vor die Tür. Rund 1.800 politisch motivierte Straftaten hat die Polizei seit dem 7. Oktober gezählt. Umgekehrt sehen sich auch unbeteiligte Muslime dem pauschalen Vorwurf ausgesetzt, Terrorsympathisanten zu sein. Inzwischen überzieht auch noch eine Serie von Bombendrohungen das Land, deren Absender eine Verbindung zur Hamas herstellen. Angst und Unsicherheit machen sich in Deutschland breit – sind die Sicherheitsbehörden der Herausforderung gewachsen? Wie konnte es so weit kommen? War es naiv zu glauben, dass Migranten muslimischer Herkunft, die vielfach mit dem Hass auf Israel groß worden sind, den an der Staatsgrenze einfach so ablegen? Oder machen wir es uns zu leicht, wenn wir glauben, dass Antisemitismus nur ein importiertes Problem ist? Studien belegen, dass dieses Gedankengut auch in rechtsextremen und in linken Kreisen Deutschlands salonfähig ist. Die Bundesregierung will mit aller Härte gegen Judenhass vorgehen, verbietet viele palästinensische Demonstrationen und drückt der israelischen Regierung uneingeschränkte Solidarität aus, was wiederum bei Migranten mit muslimischen Wurzeln für Empörung sorgt: Denn sie wollen, dass auch das Leid der Menschen in Gaza gesehen wird. So wie es UNO-Generalsekretär Guterres diese Woche im Sicherheitsrat gemacht hat, als er darauf hinwies, dass der Terror der Hamas im Kontext der israelischen Besatzungspolitik bewertet werden muss. Das hat ihm viel Kritik eingebracht. Deutschland hat sich nach dem Holocaust geschworen: “Nie wieder!” Bedeutet das, dass sich auch aktuell Kritik an Israel verbietet? Die Gäste: • Kristin Helberg, Freie Journalistin Die freie Journalistin und Politikwissenschaftlerin Kristin Helberg berichtete sieben Jahre lang aus Syrien über den Nahen und Mittleren Osten für den ARD-Hörfunk sowie verschiedene Print- und Onlinemedien. Heute arbeitet sie als Autorin und Nahostexpertin in Berlin. Im Herder Verlag erschienen ihre Bücher „Verzerrte Sichtweisen – Syrer bei uns. Von Ängsten, Missverständnissen und einem veränderten Land“ (2016) und „Der Syrien-Krieg. Lösung eines Weltkonflikts“ (2018). • Ronen Steinke, Rechtspolitischer Redakteur, Süddeutsche Zeitung Ronen Steinke studierte Jura- und Kriminologie und promovierte in Völkerstrafrecht. Er arbeitete in Anwaltskanzleien, einem Jugendgefängnis und beim UN-Jugoslawientribunal in Den Haag. Seit 2011 ist Ronen Steinke bei der „Süddeutschen Zeitung“ als Redakteur und rechtspolitischer Korrespondent. Er veröffentlichte mehrere Bücher, wie 2020 „Terror gegen Juden. Wie antisemitische Gewalt erstarkt und der Staat versagt“. Zuletzt erschien 2023 „Verfassungsschutz – Wie der Geheimdienst Politik macht“. • Theresa Weiß; Redakteurin, Rhein-Main-Teil, Frankfurter Allgemeine Zeitung Theresa Weiß studierte in Halle/Saale und Tartu (Estland) Politikwissenschaft und Philosophie, anschließend osteuropäische Politik und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München mit Aufenthalt in Kirgistan. Stationen in der deutschen Botschaft in Moskau, im Bundestag und bei einem Projekt der EU in Danzig. Seit 2016 arbeitet sie in unterschiedlichen Positionen bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo sie auch volontierte. 2017 verbrachte sie als Stipendiatin des Marion-Gräfin-Dönhoff-Programms zwei Monate bei der unabhängigen russischen Zeitung Novaya Gazeta in Moskau, 2022 als Stipendiatin des Kramer-Kollegs zwei Mo nate bei Haaretz in Tel Aviv, Israel. Als Redakteurin in der Rhein-Main-Redaktion berichtet sie über das gesellschaftliche Leben in Frankfurt, über soziale Themen und das jüdische Leben. • Burak Yilmaz, Autor und Pädagoge Burak Yilmaz lebt als selbstständiger Pädagoge und Autor in seiner Heimatstadt Duisburg. Yilmaz leitete von 2012-2019 das Projekt „Junge Muslime in Auschwitz“. In seinem Buch „Ehrensache: Kämpfen gegen Judenhass“ schildert er eindrückliche Erlebnisse aus seiner Arbeit an Schulen und Gefängnissen. Als Autor hält er Vorträge zu den Themen Erinnerungskultur, Rassismus und Islamismus. Yilmaz ist im Beraterkreis des Bundesbeauftragten gegen Antisemitismus Dr. Felix Klein und fasst in seinem Podcast „Brennpunkt" einmal die Woche die heißen Eisen der Brennpunktthemen auf. Für sein vielfältiges Engagement gegen Rassismus und Antisemitismus sowie für eine inklusive Erinnerungskultur bekam Yilmaz vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich das Bundesverdienstkreuz verliehen. Im ARD-Presseclub diskutieren Journalistinnen und Journalisten aus dem In- und Ausland aktuelle politische Ereignisse und Entwicklungen. Im Dialog entsteht ein Wettstreit der Meinungen und Interpretationen aktueller politischer Vorgänge. Durch die Sendungen führen im Wechsel Volker Herres, Jörg Schönenborn und Sonia Seymour Mikich. Im anschließenden „Presseclub nachgefragt“ können Zuschauerinnen und Zuschauer über die WDR 5 Hotline mit den Beteiligten der Sendung weiterdiskutieren und Fragen stellen.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in