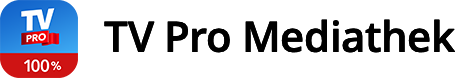Presseclub
Zeitgeschehen
Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine hat den politischen Kampf gegen den Klimawandel ausgebremst. Seither fahren wir kurzfristig wieder Kohlekraftwerke hoch, importieren Flüssiggas und nutzen Öl zur Stromerzeugung. Eine globale Tendenz. Langfristig hält die Weltgemeinschaft aber nach wie vor an ihrem Versprechen fest, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wie das trotz zunehmender Konflikte gelingen kann, darüber diskutieren ab Sonntag rund 200 Staaten zwei Wochen lang im ägyptischen Badeort Scharm El-Scheich. Ist das Ziel überhaupt noch zu schaffen oder frommer Selbstbetrug? Die Prognosen sind düster. Selbst wenn alle vorliegenden Klimapläne realisiert würden, steuert die Welt am Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung von weit über zwei Grad zu, so die Vereinten Nationen. Das Problem: Fast alle Staaten reißen ihre ambitionierten Ziele, auch Deutschland: Der Rückgang der Emissionen reiche nicht aus, um die nationalen Klimaschutzziele bis 2030 zu realisieren, so das aktuelle Gutachten des Expertenrates. Das gilt auch weltweit: Nach Berechnungen des UN-Klimasekretariats werden die CO2-Emissionen in den nächsten sieben Jahren sogar noch um 10,6 Prozent zunehmen. Eine alarmierende Prognose mit unvorhersehbaren Konsequenzen für Mensch und Natur, die wir schon jetzt hautnah zu spüren bekommen. Was also tun? Ist ein beherztes gemeinsames Anpacken der Staatengemeinschaft überhaupt realistisch, angesichts wachsender internationaler Spannungen und Konflikte? Viele junge Klimaaktivisten der “Last Generation” glauben nicht mehr daran, weshalb sie zu immer radikaleren Methoden greifen. Verständlich oder können wir diese Menschheitsaufgabe doch noch lösen? Wie steinig wird der Weg? Denn zumindest eine positive Botschaft gibt es auch: Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind die Investitionen in nachhaltige Energien weltweit gestiegen. Könnte die Krise vielleicht sogar einen Innovationsschub auslösen und die Energiewende beschleunigen? Gäste • Ulrike Herrmann, taz.die tageszeitung • Jakob Schlandt, Tagesspiegel • Horst von Buttlar, Capital • Petra Pinzler, DIE ZEIT • Ellen Ehni , Chefredakteurin, WDR-Fernsehen Ellen Ehni studierte deutsches und französisches Recht in Köln und Paris und absolvierte das juristische Staatsexamen in Berlin. Nach dem Volontariat beim NDR wurde sie Redakteurin bei „NDR aktuell“ und Reporterin für „tagesschau“ und „tagesthemen“. 2004 wechselte Ellen Ehni zum WDR und betreute als Redakteurin die Sendungen „ARD Ratgeber Recht“, „Markt“ und „Plusminus“. 2007 ging sie für fünf Jahre als Fernsehkorrespondentin der ARD nach Paris. 2012 kehrte sie als Leiterin der Programmgruppe „Wirtschaft und Recht“ nach Köln zurück. Im Januar 2017 wurde sie Chefin der Programmgruppe „Zeitgeschehen, Europa und Ausland“ im WDR-Fernsehen. Seit 2014 präsentiert sie den ARD-DeutschlandTrend in den „tagesthemen“. Seit September 2018 ist Ellen Ehni Chefredakteurin des WDR-Fernsehens. Die Gäste • Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin, taz.die tageszeitung Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau besuchte Ulrike Herrmann die Henri-Nannen-Schule und studierte Geschichte und Philosophie an der FU Berlin. Anschließend arbeitete Herrmann als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Körber-Stiftung und Pressesprecherin der Hamburger Gleichstellungs-Senatorin Krista Sager. Im Jahr 2000 wechselte sie dann zur taz, wo sie als Parlamentskorrespondentin, Leiterin der Meinungsredaktion und jetzt als Wirtschaftskorrespondentin arbeitet. Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher. Zuletzt erschien im September 2022 „Das Ende des Kapitalismus. Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden“. • Petra Pinzler, Korrespondentin im Hauptstadtbüro, DIE ZEIT Petra Pinzler ist seit Herbst 2007 Mitglied des Hauptstadtbüros der Wochenzeitung DIE ZEIT. Ihre Schwerpunkte sind Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik. Nach einem Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften sowie dem Besuch der Kölner Journalistenschule war sie für verschiedene öffentlich-rechtliche Rundfunkstationen tätig. 1994 ging sie zur ZEIT, wo sie zunächst in der Wirtschaftsredaktion arbeitete. 1998 wechselte sie als USA-Korrespondentin des Wochenblattes nach Washington und 2002 als Europa-Korrespondentin nach Brüssel. Sie schrieb mehrere Bücher. Zuletzt veröffentlichte sie 2019 gemeinsam mit Andreas Sentker das Buch „Wie geht es der Erde? Eine Bestandsaufnahme“. • Jakob Schlandt, Redaktionsleiter Background Energie&Klima, Tagesspiegel Jakob Schlandt ist seit 2017 Redaktionsleiter von Tagesspiegel Background Energie & Klima. Das sechsköpfige Team berichtet in einem eigenen Briefing seit fünf Jahren täglich über die Themenfelder, insbesondere Politik und Regulierung. Schlandt schloss jüngst einen Master of Business Administration an der University of London ab. Als Journalist volontierte der gebürtige Münchner bei der Berliner Zeitung und arbeitete dort für die DuMont-Zentralredaktion ab 2005 als Wirtschaftsredakteur, bis er ab 2013 als freier Journalist tätig war. • Horst von Buttlar , Chefredakteur, Capital Horst von Buttlar ist Autor des Buches. „Das grüne Jahrzehnt“, das Ende September erschienen ist, und Moderator des erfolgreichen Wirtschaftspodcasts „Die Stunde Null“. Er studierte Slawistik, Geschichte und Politikwissenschaften in Heidelberg, St. Petersburg und Berlin und absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München. 2004 ging er als Redakteur zur Financial Times Deutschland (FTD) und übernahm 2007 die Leitung des Reporterteams, 2009 wurde er Ressortleiter bei den G+J Wirtschaftsmedien (FTD, Capital, Impulse, Business Punk). 2005 wurde er mit dem Theodor-Wolff-Preis ausgezeichnet. 2008 bekam er den Herbert-Quandt-Medien-Preis für Wirtschaftspublizistik verliehen, 2019 wurde er als „Wirtschaftsjournalist des Jahres“ ausgezeichnet. Heute ist er Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Capital. Der Presseclub ist eine aktuelle Diskussionssendung, in der das jeweils wichtigste politische Thema der Woche aufgearbeitet wird. Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Standpunk ten analysieren aus unterschiedlichen Blickwinkeln politische Ereignisse und Entwicklungen. Dabei wird der Hintergrund von Schlagzeilen aufgehellt, und es entsteht im Dialog ein Wettstreit um die Interpretation von politischen Vorgängen. Für das Publikum ergibt sich damit ein Angebot von Meinungen, die sich in der Diskussion überprüfen lassen müssen und auf diese Weise ihre Glaubwürdigkeit und Plausibilität unter Beweis stellen müssen.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in