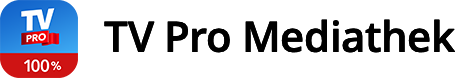Presseclub
Zeitgeschehen
Selenskyjs Hilferufe bleiben ungehört: Die Bundesregierung hat keine Freigabe für die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern erteilt, auch nicht ihren Verbündeten. Sie will aber ihre eigenen Bestände in der Industrie und bei der Bundeswehr überprüfen. Nur zu dieser Zusage hat sich Verteidigungsminister Pistorius in Ramstein durchgerungen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ob die Ukraine tatsächlich irgendwann den deutschen Kampfpanzer Leopard bekommt, um sich gegen Russland wehren zu können, ist also weiter offen. Der ganze Druck auf Kanzler Scholz und die Bundesregierung hat nichts gebracht – obwohl die Erwartungshaltung an ihn enorm ist: Nicht nur von der Ukraine, den NATO-Partnern, vom EU-Parlament, von CDU/CSU, sondern vor allem auch von seinen eigenen Koalitionspartnern FDP und Grüne. Warum zögert der Kanzler, den Leopard freizugeben? Beobachter sind sich einig, dass die Verteidigungspolitik nach wie vor im Kanzleramt gemacht wird. Warum riskiert Scholz, außenpolitisch als Bremser dazustehen? Warum riskiert er als Schuldiger für das Sterben von Zivilisten in der Ukraine verantwortlich gemacht zu werden? Bisher gibt es bei Putin keine Anzeichen dafür, seinen brutalen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Im Gegenteil. Politische Beobachter befürchten sogar eine neue Großoffensive in diesem Frühjahr. Könnte der Leopard das Blatt auf dem Schlachtfeld wenden? Was passiert, wenn das nicht ausreicht, um die konventionelle Überlegenheit der Russen zu brechen? Liefert die NATO dann demnächst Kampfflugzeuge? Welche Strategie verfolgt der Westen im Krieg zwischen Russland und der Ukraine? Offiziell heißt es, Russland dürfe nicht gewinnen, die Ukraine nicht verlieren. Was heißt das genau? Offiziell will der Westen nicht Kriegspartei werden – aber ist er das nicht schon längst, wie es Pistorius vor seiner Vereidigung zum neuen Verteidigungsminister selbst formuliert hat? Gäste: • Eric Bonse, Freier Journalist und EU-Korrespondent der taz. die tageszeitung Seit 2004 berichtet Eric Bonse als akkreditierter EU-Korrespondent aus Brüssel - zunächst für das "Handelsblatt", seit 2011 für die "taz" und andere Medien wie "Cicero", "Focus" oder "Europe.Table". In seinem Newsblog "Lost in Europe" greift er mit spitzer Feder aktuelle europapolitische Themen auf. Der Diplom-Politikwissenschaftler hat mehrere Bücher und Studien über die EU veröffentlicht. Zuletzt erschienen: "Überforderter Motor: Die deutsch-französische Europapolitik aus Brüsseler Sicht" (Stiftung Genshagen) • Nana Brink, Freie Journalistin Nana Brink studierte Geschichte und Literatur in Berlin, volontierte beim „Tagesspiegel“ und arbeitete ab 1989 für mehrere Tageszeitungen und Wochenmagazine. Von 1994 bis 1998 war sie Korrespondentin in Sachsen und Brandenburg für verschiedene Medien. Seit 1999 arbeitet sie als freie Moderatorin und Autorin für das Deutschlandradio. Zwischen 2012 und 2018 war sie immer wieder unter anderem für „Deutschlandfunk Kultur“ als Sonderkorrespondentin in den USA. Zudem schreibt sie für die Zeitschrift „Internationale Politik“ und den sicherheitspolitischen Newsletter „Security.Table“. Ihr Themenschwerpunkt ist vor allem die Sicherheitspolitik. Seit 2007 ist Nana Brink mit Unterbrechungen stellvertretende Vorsitzende von WIIS.de - einem Netzwerk, das über 670 Frauen in der Sicherheitspolitik in Deutschland zählt. • Stefan Kornelius, Ressortleiter Politik, Süddeutsche Zeitung Stefan Kornelius leitet das Politik-Ressort der "Süddeutschen Zeitung" seit 2021. Er besuchte die Henri-Nannen-Journalistenschule, studierte anschließend Politik, Geschichte und Staatsrecht in Bonn und London. Zudem war er Mitbegründer der Journalistenzeitschrift „medium magazin“. Nach Mitarbeit beim "Stern" und bei der „BBC“ berichtete er ab 1992 als politischer Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ aus Bonn über die CDU, Verteidigung und Sicherheitspolitik. Später war er US-Korrespondent in Washington und stellvertretender Leiter des Berliner Büros der „Süddeuts chen Zeitung“. Ab 2000 leitete Stefan Kornelius das Ressort Außenpolitik und schrieb vor allem über Europa- und Sicherheitspolitik. • Paul Ronzheimer, Stellv. Chefredakteur, Kriegs- und Krisenreporter, BILD Paul Ronzheimer volontierte bei der „Emder Zeitung“ und arbeitete dort ab 2005 als Redakteur. 2008 wechselte er an die Axel-Springer-Akademie und war von 2009 bis 2011 als Parlamentskorrespondent der BILD in Berlin. 2012 wurde er Chefreporter im Ressort für Politik und berichtete vor allem aus Kriegs- und Krisengebieten und 2019 stellvertretender Chefredakteur mit Zuständigkeit insbesondere für Reporter und Reportage. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine berichtet er immer wieder als Live-Reporter von vor Ort. Paul Ronzheimer wurde mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt zeichnete das Fachmagazin „medium magazin“ Paul Ronzheimer und Katrin Eigendorf (ZDF) für ihre Berichterstattung aus der Ukraine als „Journalistin & Journalist des Jahres 2022“ aus. Moderation: • Ellen Ehni , Chefredakteurin, WDR-Fernsehen Ellen Ehni studierte deutsches und französisches Recht in Köln und Paris und absolvierte das juristische Staatsexamen in Berlin. Nach dem Volontariat beim NDR wurde sie Redakteurin bei „NDR aktuell“ und Reporterin für „tagesschau“ und „tagesthemen“. 2004 wechselte Ellen Ehni zum WDR und betreute als Redakteurin die Sendungen „ARD Ratgeber Recht“, „Markt“ und „Plusminus“. 2007 ging sie für fünf Jahre als Fernsehkorrespondentin der ARD nach Paris. 2012 kehrte sie als Leiterin der Programmgruppe „Wirtschaft und Recht“ nach Köln zurück. Im Januar 2017 wurde sie Chefin der Programmgruppe „Zeitgeschehen, Europa und Ausland“ im WDR-Fernsehen. Seit 2014 präsentiert sie den ARD-DeutschlandTrend in den „tagesthemen“. Seit September 2018 ist Ellen Ehni Chefredakteurin des WDR-Fernsehens. Der Presseclub ist eine aktuelle Diskussionssendung, in der das jeweils wichtigste politische Thema der Woche aufgearbeitet wird. Journalistinnen und Journalisten mit unterschiedlichen Standpunkten analysieren aus unterschiedlichen Blickwinkeln politische Ereignisse und Entwicklungen. Dabei wird der Hintergrund von Schlagzeilen aufgehellt, und es entsteht im Dialog ein Wettstreit um die Interpretation von politischen Vorgängen. Für das Publikum ergibt sich damit ein Angebot von Meinungen, die sich in der Diskussion überprüfen lassen müssen und auf diese Weise ihre Glaubwürdigkeit und Plausibilität unter Beweis stellen müssen.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in