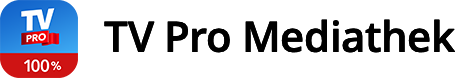Lew Kopelew - Wortwechsel
Literatur
Lew Kopelew wurde als Sohn eines jüdischen Agronomen geboren. Schon früh wurde er mit der deutschen Sprache vertraut, die während seiner Kindheit oft in seiner Umgebung gesprochen wurde. Er arbeitete nach der Grundschule zuerst in einer Lokomotivfabrik und später als Lehrer an einer Schule für Erwachsene. In seiner Jugend war er begeisterter Kommunist, fiel aber aufgrund seiner Nähe zu trotzkistischen Gedanken negativ auf. Um nicht als Abweichler Opfer der stalinistischen Säuberungen zu werden, bemühte er sich, seine kommunistische Treue durch einen gewissen Übereifer zu beweisen. Er studierte von 1933 bis 1938 Germanistik, Geschichte und Philosophie. Nach seiner Promotion arbeitete er als Dozent. Im Jahre 1941 meldete er sich als Freiwilliger zur Armee, wo er wegen seiner guten Deutschkenntnisse zum 'Instrukteur für Aufklärungsarbeit im Feindesheer' wurde. Beim Einmarsch der Roten Armee in Deutschland im Januar 1945 wurde er Zeuge zahlreicher Greueltaten gegen die Zivilbevölkerung Ostpreußens, die ihn zutiefst erschütterten. Dies löste tiefste Scham in ihm aus. Bei seinen Versuchen, Greueltaten zu verhindern, erntete er nur Unverständnis und Feindseligkeit bei seinen Kameraden und Vorgesetzten. Wegen 'Propagierung des bürgerlichen Humanismus, Mitleid mit dem Feind und Untergrabung der politisch-moralischen Haltung der Truppe' wurde er zu zehn Jahren Lagerhaft verurteilt. Nach seiner Freilassung begann er wieder zu schreiben und lernte auch bald seine spätere Frau Raissa Orlowa kennen; im Jahre 1956 heirateten sie. Lew Kopelew wurde rehabilitiert und konnte als Literaturwissenschaftler und Germanist arbeiten und veröffentlichen. Im selben Jahr hielt Chruschtschow seine berühmte Rede auf dem auf dem XX. Parteitag der KPdSU, in der er mit dem Stalinismus abrechnet. Kopelew bekam eine Stelle als Dozent für internationale Pressegeschichte. Er arbeitete von 1961 bis 1968 am Moskauer Institut für Kunstgeschichte, verfasste eine Bertolt-Brecht-Biografie und eine Geschichte der deutschsprachigen Theaterwissenschaft. Seit Mitte der sechziger Jahre setzte er sich zunehmend für Andersdenkende wie Andrei Sacharow und Alexander Solschenizyn sowie für den Prager Frühling ein. Hierdurch geriet er in immer stärkere Opposition zu dem sich wieder verhärtenden Regime. Er verlor immer mehr den Glauben an den Kommunismus und wurde, als er gegen den Einmarsch anderer kommunistischer Länder in die Tschechoslowakei und die brutale Zerschlagung aller Reformerfolge protestiert, mit Parteiausschluss, Schreibverbot und dem Verlust seiner Stelle am Institut für Kunstgeschichte bestraft. Damit endeten für ihn auch die letzten Hoffnungen, die er in den Kommunismus gesetzt hatte.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in