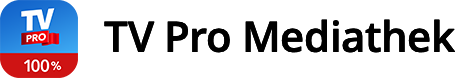Verbotenes Begehren
Folge 2 | Zeitgeschichte
Josef Kohout ist der der erste homosexuelle KZ-Häftling, der seine Geschichte öffentlich macht - und um Anerkennung kämpft. Die Dokumentation beleuchtet die Verfolgung queerer Menschen in der Nazi-Zeit - und den Umgang mit dieser Verfolgung in der Zeit danach. Wien, Ende der 60er Jahre: Unter strenger Geheimhaltung erzählt Josef Kohout dem Autor Hanns Neumann von seiner Zeit in der Hölle. Wie Tausende andere schwule KZ-Häftlinge mit dem rosa Winkel gebrandmarkt, wird Kohout fünf Jahre lang in zwei Konzentrationslagern gedemütigt und gequält. Kohout überlebt - auch, weil er sich in ein System aus sexueller Ausbeutung fügt. Dennoch wird Kohout nach 1945 jegliche Entschädigung als NS-Opfer verweigert. Der Grund: Homosexuelle Männer gelten in Österreich ebenso wie in Deutschland weiterhin als Kriminelle. Kohout wird Zeit seines Lebens gegen dieses Unrecht ankämpfen - vergeblich. Die Dokumentation zeigt, wie die Nazis die queere Subkultur, die in den 20er Jahren vor allem in Berlin aufgeblüht ist, brutal zerstören - und wie Verfolgung und Diskriminierung nach der NS-Diktatur weitergehen. Dabei spürt der Film auch dem bisher wenig beachteten Schicksal queerer Frauen in der NS-Zeit nach. Basierend auf den Erinnerungen Josef Kohouts erscheint 1972 das Buch „Die Männer mit dem rosa Winkel“. Der erste Erfahrungsbericht eines schwulen KZ-Insassen wird zum Schlüsselwerk der zweiten schwul-lesbischen Bewegung. Der rosa Winkel wandelt sich durch Kohout vom Stigma zum Zeichen der frühen Pride-Bewegung.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in