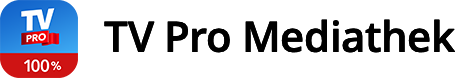Wolf und Bär - Schützen oder Schießen
Zeitgeschehen
Ein Jahrhundert nach seiner Ausrottung ist er wieder da: der Wolf. In den Ländern des Alpenraums steigt die Population der Wölfe mittlerweile jährlich um mehr als 30 Prozent. Was für die erfolgreicher europäischer Artenschutz ist, wird für andere zur existenziellen Krise. Die Reporterinnen Vanessa Böttcher und Ines Pedoth gehen in den Südtiroler und den Französischen Alpen der Frage nach, ob und wie Mensch und Wolf zusammenleben können. Weil der Wolf Schafe, Ziegen und manchmal sogar Kälber reißt, gehen die Bauern auf die Barrikaden und fordern Abschussquoten. Umweltschützer und Wildtierexperten schlagen hingegen Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune und Hirten auf den Almen vor. Befürworter und Gegner spalten den Alpenraum. Schafzüchter in Südtirol, deren Herden von Wölfen angegriffen wurden, fürchten um ihre Existenz und würden Raubtiere wie Wölfe und ausgewilderte Bären am liebsten wieder gänzlich verschwinden sehen. "Es wird von Tag zu Tag schlimmer, wir müssen die Stalltüren zusperren, sonst haben unsere Tiere keine Chance, zu überleben", sagt Konrad Senn, Landwirt und Vizebürgermeister der Gemeinde Villanders. Auf Frankreichs Almen liegt die Saisonarbeit als Schafhirte im Trend, die meisten Schäfer halten Herdenschutzhunde, um Wolfsattacken zu verhindern. "Es ist das schönste Büro der Welt", erzählt Julien Tack, der vier Monate im Jahr für über 1000 Schafe verantwortlich ist. In Frankreich wird jedes Jahr der Abschuss von 150 bis 200 Wölfen offiziell genehmigt. Eine eigene Einheit aus freiwilligen Jägern, die "Lieutenants de louveterie", regulieren den Bestand der Wölfe. Die Dokumentation zeigt sie bei ihrem Einsatz.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in