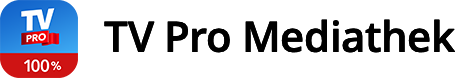Campus Talks
Gespräch
• Prof. Dr. Louisa Kulke: Wie sich Aufmerksamkeit entwickelt Die Flexibilität der Augen hat einen entscheidenden Anteil daran, dass wir auf Menschen in unserer Umwelt adäquat reagieren können. Die Entwicklungspsychologin Louisa Kulke zeigt, wie sich die Flexibilität der Augen mit zunehmendem Alter verändert und wie sie trainiert werden kann. In jedem Moment prasseln zahlreiche Informationen auf uns ein und wir Menschen sind in der Lage, unsere Aufmerksamkeit gezielt auf diejenigen Dinge zu richten, die für unsere zukünftigen Handlungen am relevantesten sind. Diese Fähigkeit muss sich aber erst entwickeln. Säuglinge sind noch nicht in der Lage, ihre Aufmerksamkeit zu verschieben – im Gegenteil: sie starren diejenigen Dinge an, die gerade in ihr Blickfeld fallen und haben Schwierigkeiten, sich davon zu lösen. Die Befähigung, Aufmerksamkeit flexibel zu verschieben, entwickelt sich erst im Säuglingsalter und wird in unserer Forschung mittels Eye-tracking (zur Untersuchung von Augenbewegungen) und Elektroenzephalographie (EEG, zur Messung von Hirnströmen) untersucht. Diese Kompetenz spielt auch in sozialen Interaktionen eine Rolle: während es beim Netflix schauen auf der Couch völlig in Ordnung ist, den Schauspielern in die Augen zu sehen, ist es gesellschaftlich weniger anerkannt, fremde Menschen im Bus anzustarren. Das flexible Bewegen der Augen spielt also sowohl für Aufmerksamkeit als auch für soziale Interaktionen eine wichtige Rolle. EEG Befunde zeigen, dass sich die Gehirnmechanismen der Aufmerksamkeit vom Säuglings- zum Erwachsenenalter verändern und automatisieren, sodass Erwachsene flexibel kontrollieren können, wohin sie sehen. • Kevin Schmitz: Pilze als Medizin? Warum Pilze wichtig für die Entwicklung von neuer Antibiotika sind. Jeder Pilz hat rund 15.000 Gene, jedes mit einer spezifischen Funktion. Nicht immer benötigt der Pilz alle Funktionen. Durch Gen-Regulation stellt sich der Pilz auf seine Umgebung ein. Der Biotechnologe Kevin Schmitz zeigt, wie diese Gen-Regulation für die Entwicklung neuer Antibiotika genutzt werden kann. Ein durchschnittlicher Pilz hat ca. 15.000 Gene, und jedes Gen hat dabei eine ganz spezifische Funktion. Nicht zu jedem Zeitpunkt wird aber jede dieser 15.000 Funktionen tatsächlich benötigt. Genau wie andere Lebewesen auch haben Pilze daher Mechanismen entwickelt, um bei Bedarf „benötigte“ Gene/Funktionen „anzuschalten“ und aktuell „nicht benötigte“ Gene/Funktionen „auszuschalten“. Diesen Vorgang nennt man Gen-Regulation. Die Gen-Regulation ermöglicht es dem Pilz in der Natur, sich ideal auf die vorliegenden Bedingungen in seiner Umgebung einzustellen. Die Pilz-Biotechnologie versucht, biologische Prozesse aus Pilzen technisch und industriell nutzbar zu machen. Konkret heißt das z.B. einen chemischen Stoff wie Penicillin, den ein Pilz natürlicherweise bilden kann, in großem Maßstab nach ökonomischen Gesichtspunkten herzustellen. In der Biotechnologie ist es daher oft notwendig, bestimmte Gene und Funktionen deutlich stärker zu aktivieren, als der Pilz dies natürlicherweise tun würde. Kevin Schmitz beforscht daher gentechnische Methoden, um gezielt Gene und Funktionen anzuschalten. Anders als Tiere sind Pilze an einen festen Standort gebunden – sie können bei Bedrohung durch Konkurrenten oder Feinde also nicht davonlaufen. Pilze haben daher im Laufe der Evolution auch die Fähigkeit entwickelt, verschiedene chemische Stoffe zu bilden und in ihre Umgebung abzusondern. Diese können entweder als natürliche Waffe gegen Konkurrenten in der Umgebung wirken, oder aber sogar Organismen fördern, die dem Pilz nutzen. Solche Stoffe sind für die Medizin eine wahre Fundgrube auf der Suche nach neuen Wirkstoffen zur Heilung von Krankheiten. Allerdings bilden Pilze diese größtenteils noch unentdeckten Substanzen i.d.R. nur unter ganz speziellen, aber völlig unbekannten Bedingungen. Die zuständigen Gene sind also normalerweise ausgeschaltet. Mithilfe unserer gentechnischen Methoden können wir diese Gene a llerdings auch künstlich anschalten. So können vielversprechende, neue Substanzen gebildet und für die Wirkstoff-Forschung nutzbar gemacht werden – zum Beispiel, um neue Antibiotika zu finden.
Diese und 50.000 weitere Sendungen in